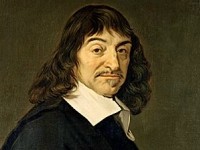
Descartes: Cogito, ergo sum.von Simon Hollendung
|
2.4 Neue Wissenschaft oder neue Scholastik?
Descartes weist oft darauf hin, dass er mit vielen alten Denkweisen gebrochen hat. Doch vollzieht sich beim genaueren Hinsehen kein so radikaler Bruch, wie der Philosph uns glaubend machen will. Aus der Seelenlehre des Aristotels entfernt er den Zweckbegriff und gibt mechanische Erklärungen, wo der griechische Denker pflanzliche und tierische sah. Und doch ist dieser vermeintliche Bruch vor allem durch eine andere Ausrichtung und der neuen Erkenntnissen seiner Zeit entstanden.[23] In den wichtigsten Denkgewohnheiten trennt sich Descartes nicht von Aristoteles und dessen durch viele Jahrhunderte anerkannten Denkart. So geht auch Descartes von der Seele als Entelchie aus, deren Energie sich im Erkennen entfaltet.[24]
Für Karl Jaspers stellt Descartes der Scholastik keine neue Wissenschaft entgegen, sondern formt aus den neuen Wissenschaften eine neue Scholastik und positioniert sich damit "gegen den Sinn dieser neuen Wissenschaft."[25] Historisch passte seine Art, die Dinge im Ganzen erfassen zu wollen, sehr gut in den Zeitgeist. Die Menschen seiner Zeit wollten, ohne dass sie es je zugegeben hätten, neue einfache Dogmen mit denen sich restlos alles erklären liesse. Ein einfacher, mechanischer Vorgang als Erklärung war stets willkommen. Descartes Weltbild kam bei den Mitmenschen die es verstanden, sehr gut an. Ein Umstand, den man bei den Einwänden zu den Mediationes und der Werkgeschichte kaum glauben mag. "Die Philosophie des Descartes gewann außerordentlich an Prestige, als ob sie faktisch durch praktische Erfolge bestätigt werde."[26]
Wie für viele andere, so sind auch für Wolfgang Röd die Berührungspunkte zwischen Descartes und der Scholastik in La Flèche zu finden. Trotzdem sieht er den Versuch, Descartes als Fortsetzer der Scholastik zu sehen, scheitern. "[W]eil in seiner Philosophie das Verhältnis von Theorie und Praxis in einer der scholastischen Tradition fremden Weise bestimmt und der Mathematik und den mathematischen Naturwissenschaften eine Rolle zuerkannt wird, die ihnen von der Tradition nicht zugebilligt worden war."[27]
Ebenso wie Jaspers billigt Röd Descartes somit einen wesentlich größeren praktischen Anteil als der scholastischen Tradition zu. Dieses Gefühl, das seine Philosphie auch praktisch erfolgreich sein könnte, gab Descartes die Annerkennung seiner Zeit. Diese wäre auch offen zu Tage getreten, hätte sich der Philosoph nicht geschickterweise im Untergrund aufgehalten. Hätte er seine Philosphie offensiver platziert, wäre ihm ein ähnliches Schicksal wie vielen Denkern, die mit der kirchlichen Weltsicht brachen, nicht erspart geblieben. Descartes nahm regen Anteil am Schicksal Galileo Galilei teilte er doch viele seiner Gedanken und hatte dadurch Motivation genug, verdeckt zu arbeiten. Das für die Menschen befreiende, praktische Element der cartesianischen Philosophie wird deutlich, wenn man sich die bis ins Letzte theoretisierten Diskussionen der Scholastik verdeutlicht. Die Weltfremdheit dieser Denkweise wird in der berühmten Diskussion, wie viele Engel auf eine Nadelspitze passen, deutlich.
[24] Vgl. Rene Descartes, Meditationes de Prima Philosophia. Vor allem in der zweiten
Meditation entfaltet Descartes seine Seelenlehre.
[25] Jaspers, Karl: Descartes und die Philosophie. Berlin, Leipzig 1937. S. 96.
[26] Ebd, S. 96 f.
[27] Röd, Wolfgang (Hrsg.): Die Philosophie der Neuzeit, S. 49.
Inhalt
- Descartes: Cogito, ergo sum
- 1.1 Der Weg zum methodischen Zweifel
- Die Radikalisierung des methodischen Zweifels
- 1.3 Was ist klare und distinktive Wahrheit?
- 2.1 Die Grenzen des Zweifels in Descartes Epoche
- 2.2 Die Scholastik
- 2.3 Descartes und die Autoritäten
- 2.4 Neue Wissenschaft oder neue Scholastik?
- 3. Von der Radikalisierung des methodischen Zweifels zum Cogito, ergo sum
- 4.1 Die verschiedenen Formulierungen des Cogito
- 4.2 Die Vorläufer des Cogito, ergo sum
- 4.3 Kein enthymematischer Syllogismus
- 4.4 Die Besonderheiten des Cogito
- 4.5 Das "Ich" im Cogito
- 4.6 Das "ergo" im Cogito-Argument
- 4.7 Der Seinsbegriff im Cogito-Argument
- 4.8 Der temporale Aspekt des Cogito, ergo sum
- 5. Descartes Trennung zwischen res cogitans und res extensa
- 6. Das angeborene Wissen
- 7. Das Cogito ergo sum und die heutige Theologie
- Zu guter Letzt
- Literaturverzeichnis
- Links